Der Kinofilm „Little Women“ ist die mittlerweile vierte große Verfilmung (neben einiger TV-Produktionen) des gleichnamigen Romans von Louisa May Alcott aus dem Jahr 1869. Was hat es auf sich mit diesem Stoff, der auch nach 150 Jahren noch immer seine Relevanz hat?
„Little Women“ dreht sich um das Leben der Familie March zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges. Die vier Schwestern Meg, Jo, Beth und Amy verleben eine behütete und fröhliche, wenn auch nicht gänzlich sorgenfreie Jugend mit ihrer Mutter „Marmee“, während der Vater an der Front kämpft. Trotz unterschiedlicher Charaktere eint alle vier Schwestern ihr gutes Herz, ihr Zusammenhalt – und das Schicksal, Frauen zu sein. Dies bedeutete zu damaligen Zeiten vor allem, auf eine Ehe angewiesen zu sein. Jo jedoch, die zweitälteste Tochter, ist die Rebellin der Familie und macht keinen Hehl daraus, niemals heiraten und dadurch ihre Unabhängigkeit aufgeben zu wollen. Sie träumt von einer Karriere als Schriftstellerin. Doch dieser Weg ist kein leichter…
„Little Women“ ist ein Stück aus seiner Zeit, in der die Lebenswege von Frauen vorgezeichnet waren – und damit ringen auch die March-Schwestern, jede auf ihre Weise. Letztlich jedoch finden sie ihre für sich jeweils passenden Lösungen in einer Gesellschaft mit begrenzten Möglichkeiten. Insofern bleibt „Little Women“ auch nach 150 Jahren noch eine sinnbildliche Geschichte weiblicher Emanzipation, auch wenn jede Generation den Fokus etwas anders legte. Viel dreht sich in Greta Gerwigs Verfilmung um Geld. Jo arbeitet stets daran, ihr eigenes Geld zu verdienen, Meg leidet darunter, immer zu wenig Geld zu haben, Amy bekommt von ihrer Tante eingetrichtert, nur durch eine reiche Heirat an genug Geld kommen zu können, um ihre Familie versorgen zu können. Finanzielle Ab- beziehungsweise Unabhängigkeit ist eine zentrale Sorge der „kleinen Frauen“ – und damit stehen sie im 19. Jahrhundert vielleicht gar nicht so viel anders da als viele Frauen auch heute noch.
Jo March – Vorbild und Kindheitsheldin für Generationen
Ich verbinde von früher Kindheit an viele Emotionen mit dem Charakter Jo March. Sie begegnete mir erstmals im Kindergartenalter in Form der Animeserie „Eine fröhliche Familie“ auf RTL2. Schon damals war ich fasziniert von Jo – ich glaube, einerseits wollte ich so sein wie sie, sah mich in ihr, und andererseits war ich verknallt in sie. Jo war nicht wie die anderen braven Mädchen. Sie war frech, lustig, voller Träume – und sie schrieb! Ihre Zukunftsträume beinhalteten Selbstverwirklichung und, im Gegensatz zu den Plänen der ihrer Schwestern, partout keine Heirat. Die Anime-Serie erzählte nicht das ganze Buch und endete an diesem Punkt.
Vielleicht kennt jemand von euch noch diese wunderbare Serie?!
Als ich erfuhr, wie es mit Jo laut Roman tatsächlich weitergehen würde, brach es mir das Herz. Jo heiratet einen alten bärtigen Professor, für den sie auch noch das Schreiben aufgibt und mit dem sie eine Schule für Jungs (!) gründet. Wow. Welch ein Bruch mit allem, von dem ich glaubte, das es uns verbinden würde. Damit war die Geschichte für mich lange Zeit schlicht gestorben. Meine Kindheitsheldin hatte sich als Enttäuschung entpuppt.
Jahre später erfuhr ich, dass Jo sich fügen musste – weil die Autorin Louisa May Alcott sich fügen musste.
Jo March – Beispiel der ewigen Zerrissenheit zwischen Emanzipation und Anpassung
Louisa May Alcott hatte Jo in Anlehnung an sich selbst geschrieben. Auch Alcott wuchs in einem Haushalt mit mehreren Schwestern auf, auch sie wurde als „der einzige Sohn der Familie“ bezeichnet, auch sie versuchte mit der Schriftstellerei Geld zu verdienen – und sie heiratete nie. Welche Gründe dies genau hatte, vermag niemand heute mehr zu sagen – doch es heißt, sie habe über sich selbst einst gesagt: „(…) ich habe mich in so viele hübsche Mädchen und kein einziges Mal in einen Mann verliebt.“ Vielleicht hatte Louisa May Alcott einen Hang zu Frauen und vielleicht hatte sie sich dies auch für Jo gedacht – doch natürlich war das ein absolutes No-Go im 19. Jahrhundert, in dem ebenfalls ein No-Go war, unverheiratet zu bleiben. Der Druck der Öffentlichkeit und vor allem des Verlegers war einfach zu groß. Auf sein Drängen (und das der Leserschaft) wurde Alcott dazu genötigt, Jo doch noch in die Ehe zu schreiben. Alles andere hätte sich nicht so gut verkauft.
Vor dem Hintergrund der Zeit und ihrer gesellschaftlichen Regeln als „Little Women“ entstand, macht Alcotts Entscheidung Jo derart zu verändern natürlich Sinn. Auch hier ist „Little Women“ ein Sinnbild der Opfer, die Frauen zu bringen hatten, immer hin und hergerissen zwischen den eigenen Wünschen und derer, die die Gesellschaft an sie richteten. Was mit Jo in dieser Geschichte passiert ist wie ein trauriges, repräsentatives Beispiel für Millionen Frauen, die von Selbstbestimmung träumten und letztlich auf dem harten Boden der Realität landeten.
„Little Women“ im 21. Jahrhundert – eine zeitlose Geschichte mit modernem Anstrich
In der neuen Verfilmung wagt Regisseurin Gerwig, die Geschichte nicht chronologisch zu erzählen und durch den ein oder anderen clever gesetzten Schnitt offen zu lassen, ob Jo nun tatsächlich in die Ehe mit – einem für diese Verfilmung deutlich aufgehübschten – Professor Bhaer geht, oder ob nur ihre Romanfigur dies tut. Immerhin – mit dieser Entscheidung lässt Gerwig den Zuschauerinnen und Zuschauern die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Variante ihnen besser gefällt und gibt so dem Stoff von 1869 einen modernen Anstrich.
Für mich persönlich ist „Little Women“ von 2019 die beste Verfilmung und Interpretation der Geschichte, die einerseits eine zeitlose Erzählung weiblicher Schicksale und Emanzipation ist – und andererseits doch so eng im Kontext ihrer Zeit verwobenen ist. Eine Versöhnung mit dem Schicksal des Charakters Jo March und ein einfach schön anzusehender Film mit großartiger (natürlich größtenteils weiblicher) Besetzung. Deshalb sollte jeder diesen Film gesehen haben.



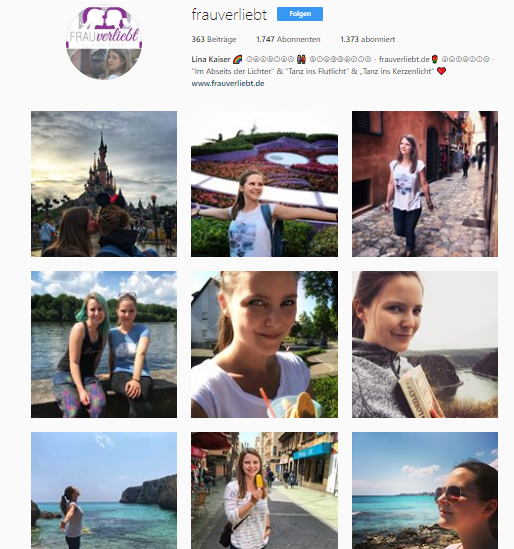

Schreibe einen Kommentar